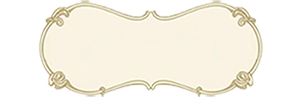Wissenswertes zur Baugenehmigung für ein Gartenhaus
Der Gartenbau eröffnet Freiräume für kreative Ideen. Dennoch muss man sich auch im eigenen Garten an Regeln halten. So ist es in bestimmten Fällen notwendig, eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus zu beantragen. Ob das erforderlich ist, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland und hängt von den baulichen Dimensionen, dem Standort und dem Nutzungszweck ab. Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen gilt es, handwerkliche und optische Aspekte unter die Lupe zu nehmen. Zur möglichen Einholung einer Baugenehmigung für das Gartenhaus kommen die Wahl eines passenden Fundaments sowie des gewünschten Materials hinzu. Wichtige Faktoren, die wir nachfolgend beleuchten.
- Übersicht zu den Bauordnungen der Bundesländer
- Gut zu wissen: Unterschied zur Gartenlaube
- Das richtige Fundament für das Gartenhaus
- Materialwahl: Holz, Kunststoff und Metall
Übersicht zu den Bauordnungen der Bundesländer
Viele Gartenbesitzer stellen sich die Frage, ab wann sie eine Baugenehmigung für ihr Gartenhaus oder ihre Gartenlaube benötigen. Hier spielt der Standort, auf dem die Maßnahmen im Gartenbau umgesetzt werden sollen, eine entscheidende Rolle. Bei Kleingartenparzellen besagt das Bundeskleingartengesetz, dass keine Baugenehmigung für das Gartenhaus nötig ist, sofern dessen Grundfläche nicht größer als 24 m² ist. Weiterhin darf das Haus in der Kleingartenparzelle in seiner Beschaffenheit, Ausstattung und Einrichtung nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein.
Geht es um einen Garten, auf dem auch das Wohnhaus steht, gibt es keine bundesweit einheitliche Regelung. Stattdessen müssen die jeweiligen Landesbauordnungen herangezogen werden. Innerhalb einer Siedlung gelten folgende Rahmenbedingungen für die Dimensionen, wenn man ein Gartenhaus ohne Baugenehmigung errichten möchte:
- Baden-Württemberg: Innenbereich bis zu 40 m³
- Bayern: Innenbereich bis zu 75 m³
- Berlin: Grundfläche bis zu 10 m²
- Brandenburg: Innenbereich bis zu 75 m³
- Bremen: Grundfläche bis zu 10 m²
- Hamburg: Innenbereich bis zu 30 m³
- Hessen: Innenbereich bis zu 30 m³
- Mecklenburg-Vorpommern: Grundfläche bis zu 10 m²
- Niedersachsen: Innenbereich bis zu 40 m³
- Nordrhein-Westfalen: Innenbereich bis zu 75 m³
- Rheinland-Pfalz: Innenbereich bis zu 50 m³
- Saarland: Grundfläche bis zu 10 m²
- Sachsen: Grundfläche bis zu 10 m²
- Sachsen-Anhalt: Grundfläche bis zu 10 m²
- Schleswig-Holstein: Innenbereich bis zu 30 m³
- Thüringen: Grundfläche bis zu 10 m²
Befindet sich der Garten im Außenbereich, sprich außerhalb des Bebauungsplans, ist generell immer eine Genehmigung erforderlich. Ausnahmen bilden Baden-Württemberg (bis 20 m³), Niedersachen (bis 20 m³), Rheinland-Pfalz (bis 10 m³) und Schleswig-Holstein (bis 10 m³). Die Baugenehmigung für ein Gartenhaus mit Aufenthaltsraum ist ebenso immer notwendig. Zusätzlich zur Größe des Hauses muss der Abstand zum Nachbarsgrundstück berücksichtigt werden. Je nach Landesbauordnung, Ausführung und Nutzungszweck ist eine direkte Grenzbebauung unter Umständen möglich. Wichtig ist, sich im Voraus mit den Nachbarn abzustimmen, um spätere Konflikte zu vermeiden.
Letztlich ist es immer ratsam, sich bei den zuständigen Behörden zu erkundigen. Weitere Informationen gibt es außerdem in diesem Ratgeber zur Baugenehmigung für ein Gartenhaus, der als E-Book kostenfrei zum Download zur Verfügung steht.
Gut zu wissen: Unterschied zur Gartenlaube
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe Gartenhaus und Gartenlaube synonym verwendet. Es ist nicht unbedingt falsch, sie gleichzusetzen. Trotzdem gibt es einen Unterschied: Eine Gartenlaube, auch Pavillon genannt, ist eine offene Konstruktion mit Überdachung. Ein Gartenhaus ist ein Gebäude, das ebenfalls überdacht ist, jedoch rundum von Wänden umschlossen ist.
Unabhängig von den baulichen Unterschieden gilt für beide, dass gegebenenfalls eine Baugenehmigung für das Gartenhaus oder die Gartenlaube eingeholt werden muss. Während Gartenlauben zumeist für den geschützten Aufenthalt im Garten dienen, werden Häuser auch zur Verstauung von Werkzeugen, Gartengeräten und mehr genutzt.
Das richtige Fundament für das Gartenhaus
Für überzeugende Ergebnisse müssen Projekte im Gartenbau gut durchdacht sein. Lange bevor man sich um die Baugenehmigung für ein Gartenhaus oder die Gartenlaube kümmert, sollte man sich Gedanken zu den erforderlichen Arbeitsschritten machen. Den ersten Ansatzpunkt bildet dabei das Fundament. Ein gut geplantes und ordnungsgemäß ausgeführtes Fundament gewährleistet die Langlebigkeit, Stabilität und Funktionalität des künftigen Gartenhauses.
Möchte man ein Fundament aus Beton gießen, kommen folgende Varianten in Frage:
- Fundamentplatte: Zusammenhängende Bodenplatte aus Beton
- Streifenfundament: Betonfundament entlang der tragenden Wände
- Punktfundament: Mehrere Punkte zur Abstützung lasttragender Pfähle
Welche Option die richtige ist, hängt von der Tragfähigkeit des Bodens im Garten, der Bauart und den Eigenschaften des Gartenhauses ab. Die durchgängige Fundamentplatte bietet eine gleichmäßige Lastenverteilung über die gesamte Struktur. Bei einem Streifenfundament wird weniger Beton benötigt, da er nur unter den tragenden Wänden verteilt wird. Das Punktfundament bietet sich für Gartenlauben und Häuser an, die auf tragfähigem Boden errichtet werden und über entsprechende Pfähle zur Abstützung der Konstruktion verfügen.
Die Kosten für ein Fundament für ein Gartenhaus hängen von vielfältigen Faktoren ab. Im Hinblick auf die Fläche, die Bauweise und das benötigte Material können sie von 90 Euro bis 300 Euro je m² reichen. Eine große Variable ist dabei, ob man das Fundament selbst legt oder von einem Gartenbau-Fachbetrieb.
Apropos Kosten: Die Baugenehmigung für ein Gartenhaus ist mit Gebühren seitens der Behörden verbunden. Diese betragen je nach Kommune rund 0,5 % des Warenwertes.
Materialwahl: Holz, Kunststoff und Metall
Das Material der Gartenlaube oder des Hauses hat nicht nur einen Einfluss auf die Optik, sondern auch auf die Haltbarkeit, den Arbeits- und Pflegeaufwand sowie den Preis. Die gängigsten Materialien sind Holz, Kunststoff und Metall.
Gartenhäuser aus Holz stellen eine nachhaltige und natürliche Option für den Garten dar. Das Material ist wärmeisolierend, atmungsaktiv und bei entsprechender Pflege sehr lange haltbar. Auf der anderen Seite ist der Aufwand für die Instandhaltung am höchsten, da Holz anfällig für Feuchtigkeit, Trockenheit und Schädlinge sein kann. Wesentlich weniger Pflege brauchen Lauben aus Kunststoff, die ab und zu gereinigt werden sollten. Zudem sind sie für Heimwerker vergleichsweise einfach aufzubauen. Dem steht ihre künstliche Optik als möglicher Nachteil gegenüber.
Die dritte Alternative liefern Gartenhäuser aus Metall. Mit einer hochwertigen, witterungsbeständigen Beschichtung benötigen auch sie keiner weiteren Zuwendung. Jedoch erhitzen sie sich gerade im Sommer sehr stark, worunter der Komfort leidet. Die Anschaffungskosten sind für hölzerne Häuser am höchsten, während Kunststoff und Metall günstigere Lösungen bieten.
Im Übrigen zählen das gewählte Material, die Bauweise und Größe, die Ausstattung sowie die Platzierung im Garten zu den Angaben, die man bei einem Antrag für eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus hinterlegen muss.
Was finde ich hier?
Hier finden Sie Wissenswertes und Tipps Rund um die Themen Baum und Garten sowie auch den passenden Fachbetrieb für Baumarbeiten oder Garten- und Landschaftsbau in Ihrer Nähe.
Neueste Beiträge
Seiten
 Sebastian Lubczynski
Sebastian Lubczynski goodRanking AINachhaltige Pflanzmethoden für den Garten
goodRanking AINachhaltige Pflanzmethoden für den Garten